Kolonialismus, Krieg und Diktatur. Gewalterfahrungen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945
Perfilado de sección
-
-
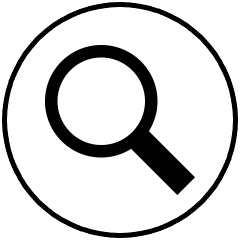 Das Floß der Medusa
Das Floß der MedusaLesen Sie nun eine Schlüsselpassage des Romans, die häufig als „Das Floß der Medusa“ (zu Beginn von Band II der ÄdW, S. 453-486) bezeichnet wird.
-

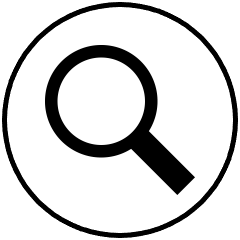 Darstellungsproblematik
DarstellungsproblematikDiskutieren Sie anhand dieser Passage die Darstellungsproblematik des historischen Erzählens, das nicht Realität abbildet, aber auch nicht (nur) Fiktion ist.
Rekonstruieren Sie, auf welche Weise Peter Weiss mit seinen Notizen gearbeitet hat. Greifen Sie dafür auf den Einleitungstext zu Peter Weiss und die CP „Historisches Erzählen in der ÄdW“ zurück.
-
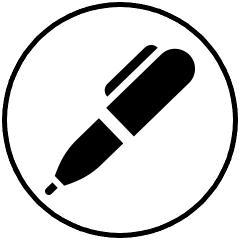 Darstellungsweise
DarstellungsweiseSchreiben Sie nun mit Blick auf die Passage "Das Floß der Medusa" einen kurzen Text (500 Wörter), in dem Sie überlegen, inwiefern das Erzählen im Roman als kollektive Erinnerungsarbeit, auch für die/den Leser:in, funktioniert. Welchen Einfluss hat zum Beispiel die Erzähl-Perspektive auf das historische und erinnernde Erzählen, welchen Herausforderungen begegnet die erzählerische Darstellung von (nicht selbst erlebten) historischen Gewalterfahrungen?
-