Kolonialismus, Krieg und Diktatur. Gewalterfahrungen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945
Perfilado de sección
-
-
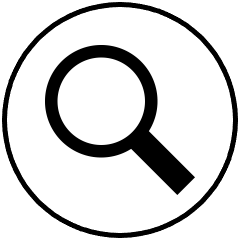 Effekte der Montagetechnik
Effekte der MontagetechnikUwe Timm wendet, wie schon erwähnt, in seinem Roman unter anderem die Montagetechnik zur Darstellung von Historizität an. Vergleichen sie das Kapitel „Allgemeine Lage“ im Roman „Morenga“ mit dem unmittelbar vorangehenden Kapitel „Zwei Positionen“ (S. 33f.) und die dazugehörigen (historischen) Quellen.
Was verändert sich? Was passiert mit dem historischen Quellenanteil im Roman und wo setzt die Fiktionalisierung ein? Welche Funktion haben die Zeit- und Datumsangaben?
-
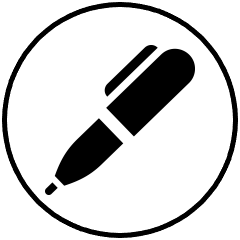 Beobachtungen zur Montagetechnik
Beobachtungen zur MontagetechnikVerfassen Sie einen Text von ca. 500 Wörtern, in dem Sie Ihre Beobachtungen zur Recherche- und Montagetechnik Timms und der literarischen Verwertung historischen Quellenmaterials in seinem Roman „Morenga“ in den beiden genannten Kapiteln beschreiben und reflektieren.
-
-
Lösungs- und Reflexionshinweis Morenga "Montagetechnik" Archivo
-
 Umgang mit Geschichte
Umgang mit Geschichte Im historischen Roman seit Walter Scott (1771-1832) finden sich oft mittlere Heldenfiguren, d.h. die Handlung wird nicht von Königen, Heerführern und Politikern beschrieben, sondern von Figuren, die mit den geschichtlichen Folgen der Entscheidungen dieser konfrontiert sind und sich in diesem Rahmen bewegen müssen.
Diskutieren Sie in Ihrer Gruppe, ob die Figur Gottschalk ein solcher mittlerer Held ist. Welche Konsequenz hat die Wahl einer solchen Figurenperspektive für die Vermittlung von Geschichte in historischen Romanen?
-
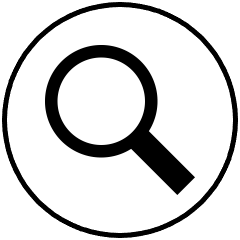 Die Figur Gottschalk
Die Figur Gottschalk Rekonstruieren Sie die Entwicklung der Figur Gottschalk. Mit welcher Motivation reist er ins Kolonialgebiet? Welche Haltung nimmt er gegenüber den Einheimischen ein? Verändert sich diese im Verlauf des Romans? Wenn ja, woran liegt dies?
Eine wichtige Quelle für den Erzähler scheint das Tagebuchs Gottschalks zu sein, aus dem immer wieder zitiert wird bzw. das als Informationsquelle angegeben wird. Was genau erfahren wir aus dem und über das Tagebuch? Wie ist dessen Überlieferungsgeschichte?
-
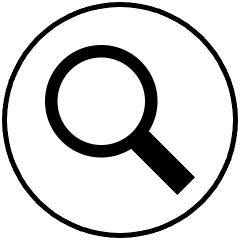 Die Figur Wenstrup
Die Figur Wenstrup Rekonstruieren Sie die Geschichte Wenstrup im Roman. Wie ist die Figur charakterisiert?
-
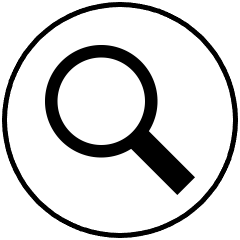 Sozialdarwinismus
SozialdarwinismusEin wichtiges Dokument, das mit der Figur verbunden ist, ist Pjotr Kropotkins Schrift „Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung“. Lesen Sie das Vorwort und das dritte Kapitel. Welche Grundposition vertritt Kropotkin? Welches Menschenbild wird darin deutlich?
Kropotkin nimmt in seiner Schrift Bezug auf Darwins Theorie der Evolution, wie es Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhundert nicht nur in der Biologie, sondern auch in den Gesellschafts- und Sozialwissenschaften nicht unüblich war. Auch der europäische Kolonialismus wurde immer wieder mit Bezug auf Darwin gerechtfertigt. Informieren Sie sich hier kurz über solche sozialdarwinistisch argumentierende Ansätze oder ausführlicher bei Kurt Bayertz: Darwinismus als Politik. Zur Genese des Sozialdarwinismus in Deutschland 1860-1900. In: Stapfia 56 (1998), S. 229-288.
Identifizieren Sie Stellen im Roman, in denen sozialdarwinistische Denkfiguren zur Legitimation der deutschen Kolonisten und ihres Rassismus zu erkennen sind. (z.B. S. 25-28, 33, 34, 40, 56)
-
 Unterschiede zwischen Darwin und Kropotkin
Unterschiede zwischen Darwin und KropotkinWelche Unterschiede erkennen Sie zwischen Kropotkins Bezug auf Darwin und der Legitimation des Kolonialismus durch Darwin? Ist Kropotkins Denken frei von Stereotypen und rassistischen Vorannahmen? Woran lässt sich dies festmachen?
-
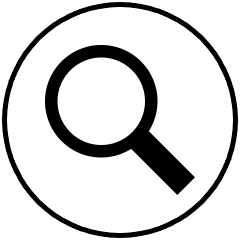 Die Figur Morenga
Die Figur Morenga Wie gestaltet sich die Informationsvergabe über die Figur Morenga? Von wem erfahren wir Was? Worüber erfahren die Leser:innen so gut wie nichts?
-
 Der „edle Wilde“
Der „edle Wilde“Diskutieren Sie, ob Morenga der Figur des „edlen Wilden“ entspricht, wie sie in Kolonialromanen des 18. und 19. Jahrhunderts oft zu finden ist.
-
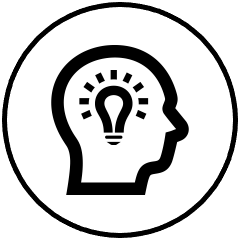 Identifikationspotential
IdentifikationspotentialBietet die Figur Morenga Ihrer Meinung nach ein Identifikationspotential an?
-

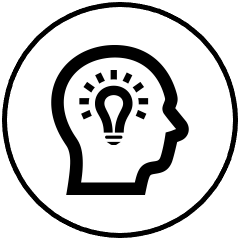 Moralische Perspektiven
Moralische PerspektivenDiskutieren Sie, welche Konsequenz Ihre Antwort für eine moralisch-ethische Interpretation des Romans haben könnte? Ist bei Timm das Bemühen eines fremdkulturellen Verstehens zu erkennen?
-
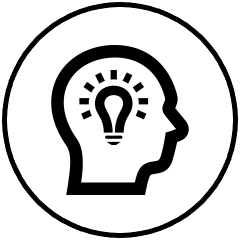 Perspektivenwahl
PerspektivenwahlWarum erzählt Timm die Kolonialgeschichte Namibias vorwiegend aus der Perspektive Gottschalks und nicht etwa aus der Sicht der Einheimischen bzw. Morengas? Welche Rolle spielen dabei vielleicht die eingerückten Quellendokumente?
Wie bewerten Sie diese Entscheidung Timms?
-