Dramaturgie der Geschlechter. Heldinnen der Komödien und Trauerspiele 1600-1800
Section outline
-
-
In Lessings Tragödienkonzeption nimmt der Begriff des Mitleids eine zentrale Stellung ein. Um zu verstehen, welche Funktion Lessing dem Affekt Mitleid zuweist, lesen Sie folgende exemplarische Quellenauszüge
- (a) Lessings Brief an Christoph Friedrich Nicolai vom November 1756 (Lessing 2003, S. 668-673)
- (b) das 78. Stück aus der „Hamburgischen Dramaturgie“.
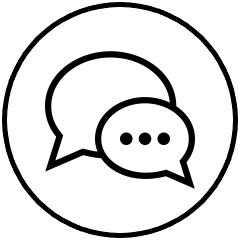
‚Verbesserung‘ des MenschenDiskutieren Sie in der Gruppe anhand der Quellenauszüge, wie nach Lessings Vorstellung die Tragödie den Menschen bessern können soll. Folgende Fragen können Ihnen Orientierung bieten:
- Was versteht Lessing unter den Begriffen Schrecken, Mitleid und Bewunderung? Warum ist „[d]er mitleidigste Mensch […] der beste Mensch“?
- Wie interpretiert Lessing Aristoteles‘ Gedanken zu Jammer („eleos“) und Schauder („phobos“)?
- Wie grenzt er sich von dem französischen Dramatiker Pierre Corneille ab?
- Wer empfindet Mitleid und Furcht in der Tragödie?
- Wie können Mitleid und Furcht im Drama erzeugt werden?
- In welchem Verhältnis steht die aristotelische Vorstellung von der tragischen Katharsis zu Lessings Mitleidskonzeption?
- Wie kann Mitleid in eine Tugend ‚verwandelt‘ werden?
-
-
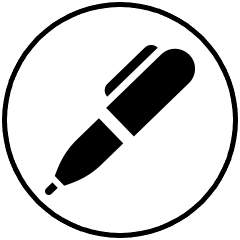
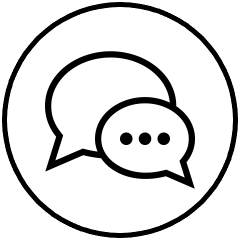
Mitleidserzeugung bei „Miß Sara Sampson“Der Gelehrte und Dichter Karl Wilhelm Ramler, Lessing freundschaftlich verbunden, war bei der Uraufführung des Stückes am 10. Juli 1755 zugegen und beschreibt die Wirkung auf das zeitgenössische Publikum wie folgt: „[D]ie Zuschauer haben drey und eine halbe Stunde zugehört, stille geseßen wie Statüen, und geweint.“ (vgl. Ramler 1971, S. 88). Die Handlung des Stückes und die Bühneninszenierung scheinen also eine affektive Wirkung erzielt zu haben.
Diskutieren Sie in der Gruppe, inwiefern die von den Figuren im Stück durchlebten Affekte darin konzeptionell (im Sinne von Lessings Mitleidsästhetik) angelegt sind.
Folgende Fragen können Ihnen Orientierung bieten:
- Nebentext: Wie oft wird in dem Stück selbst geweint?
- Sprachgebrauch: Trägt die Sprache dazu bei, Mitleid zu erzeugen (achten Sie hier insbesondere auf Satzzeichen)?
- Figurencharakterisierung: Auf welche Weise ist der Charakter Saras auf Mitleidserzeugung hin angelegt? Gibt es ‚typische‘ weibliche Attribute, die Mitleid erzeugen (Vergleich: Sara und Mellefont)?
- Handlungsführung: Wie entwickelt sich der tragische Konflikt im Zuge der Handlung?
Hören Sie sich auch gerne erneut die Podcasts unter 2.6. „Gesten der Affekte“ an, und rufen Sie sich Ihre Ergebnisse von 2.7 „Sprache der Affekte“ in Erinnerung.Halten Sie Ihre Ergebnisse in einem kurzen Text von ca. 1000 Wörtern fest.
-