Religiöse Literatur des Mittelalters. Heiligkeit – Körper – Imagination
Bölüm anahatları
-
-
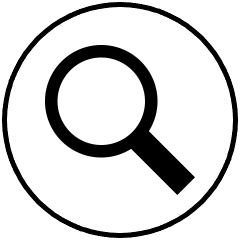 Lektüre (Vorbereitung zur großen Schreibaufgabe „Heiligkeit und Geschlecht“):
Lektüre (Vorbereitung zur großen Schreibaufgabe „Heiligkeit und Geschlecht“):Lesen Sie nun den Aufsatz von Ingrid Kasten: Gender und Legende, in: Bennewitz, Ingrid u.a. (Hgg.), Genderdiskurse und Körperbilder im Mittelalter. Eine Bilanzierung nach Butler und Laqueur, Münster u.a.: LIT Verlag 2002, S. 199-219.
Bearbeiten Sie den Text mithilfe von Cornell Notes. Eine Vorlage finden Sie in dieser Datei.Weitere grundlegende Informationen zu Cornell Notes erhalten Sie im nachfolgenden Video: -
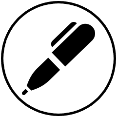
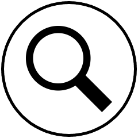 Geschlecht in Heiligenlegenden
Geschlecht in HeiligenlegendenHalten Sie in Stichworten fest: Was ist unter Geschlecht (Gender) zu verstehen, was kann der Begriff alles umfassen? Welche Bedeutungsdimensionen kann nach Kasten Geschlecht in Heiligenlegenden haben?
-

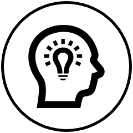 Heiligkeit und Geschlecht
Heiligkeit und GeschlechtWie erzählen die Margareta-, Euphrosyna- und Alexiuslegende von Heiligkeit, und von welcher ‚Leistung‘ der bzw. des Heiligen erzählen sie? Welche Bedeutung hat die Geschlechtsidentität im Sinne von Weiblichkeits- und Männlichkeitsmodellen in diesem Zusammenhang?
Berücksichtigen Sie bitte die folgenden Teilfragen, die Einzelaspekte der Schreibaufgabe ansprechen und die Ihnen bei der Bearbeitung helfen können.
- Worin besteht die jeweilige ‚Leistung‘ der weiblichen und des männlichen Heiligen, und wie erzählt der Text davon?
- Wie wird von der Relation zwischen der/dem Heiligen und ihrer/seiner sozialen Herkunftswelt und Sippe erzählt?
- Wie thematisieren sie die Geschlechtsidentität im Sinne von Weiblichkeits- und Männlichkeitsmodellen? (Achten Sie hierbei auch auf die Verwendung des Personalpronomens – Femininum oder Maskulinum –, z.B. in der Margaretenlegende.)
- Welche Bedeutung erhalten dabei Körper und körperliche Zeichen der jeweiligen Heiligenfigur?
- Welche Bedeutung hat die Verleugnung des Geschlechts?
Ergebnis dieses breiteren Blicks auf den Themenkomplex soll ein argumentativ zusammenhängender Text sein (ca. 2500 Wörter). Belegen Sie Ihre Ausführungen an den jeweiligen Texten und weisen Sie die von Ihnen verwendete Forschungsliteratur korrekt nach. Achten Sie unbedingt auch auf Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung.